Stahlindustrie hat den größten Anteil an den Industrieemissionen
Im Jahr 2022 verursachte die Stahlbranche rund 29 Prozent der Treibhausgasemissionen der deutschen Industrie und 6,5 Prozent der nationalen Gesamtemissionen. Damit gehört sie zu den klimaintensivsten Sektoren der deutschen Wirtschaft. Der Ausstoß von Kohlendioxid entsteht, wenn Eisenerz und Koks oder Kohle chemisch reagieren und fossile Energieträger Strom und Wärme liefern. Bereits heute haben wir Optionen, sowohl die prozess- als auch die energiebedingten Emissionen nahezu auf null zu senken.
Da zahlreiche Schlüsselbranchen auf Stahl angewiesen sind, hängen insgesamt rund vier Millionen Arbeitsplätze in Deutschland von stahlintensiven Wertschöpfungsketten ab, darunter etwa 80.000 direkt in der Stahlindustrie. Die Zukunft der Stahlproduktion ist damit eng mit der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit Deutschlands verknüpft. Um die nationalen Klimaziele zu erreichen und gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit deutscher und europäischer Industriestandorte zu sichern, müssen schnell Anreize für Investitionen in emissionsarme Technologien oder klimaneutrale Produktionsanlagen geschaffen werden.
Copyright: KEI
Chance Dekarbonisierung
So funktioniert die Stahlherstellung
weniger CO₂-Emissionen
Durch eine Dekarbonisierung der Stahlerzeugung können rund 29 Prozent der Treibhausgasemissionen der deutschen Industrie eingespart werden.
Klimawende im Hochofen: Wie die Stahlindustrie ihre Emissionen senken kann
Die Stahlproduktion gehört weltweit zu den größten Verursachern von Treibhausgasen – nicht nur wegen der Hochöfen zur Roheisenproduktion. Entlang der gesamten Prozesskette entstehen Emissionen: von der Kohlenförderung, über Kokereien und Sinteranlagen bis zur Weiterverarbeitung. Selbst die Elektrostahlroute bleibt nicht emissionsfrei.
Um die Emissionen der Stahlindustrie zu senken, muss der Produktionsprozess grundlegend umgestellt werden. Zwar erreicht man damit keine Netto-Null-Emissionen, doch lassen sich die Werte auf ein Minimum reduzieren. Die vielversprechendste Option ist der Verzicht auf Kohle, die bisher das Eisenerz im Hochofen reduziert und aufschmilzt (Hochofenroute). Die Technologien für diesen Wandel sind längst verfügbar. Bei der sogenannten Direktreduktion (DRI) kann klimafreundlicher Wasserstoff als kohlenstofffreies Reduktionsmittel eingesetzt werden, um klimafreundlichen Stahl herzustellen. Da Wasserstoff derzeit nicht in ausreichender Menge verfügbar ist, lässt sich übergangsweise auch Erdgas oder ein Gasgemisch nutzen. Der dabei entstehende Eisenschwamm – ebenso wie Stahlschrott, der jedoch nur etwa die Hälfte des deutschen Stahlbedarfs deckt – wird anschließend in einem Elektrolichtbogenofen mit erneuerbarer elektrischer Energie eingeschmolzen und zu Stahl weiterverarbeitet. Stahl, der mit einer Kombination emissionsarmer Verfahren hergestellt wird, kann heute nach dem Low Emission Steel Standard (LESS) zertifiziert werden.
Marktcheck: Klimafreundlicher Stahl
In Branchen wie der Lebensmittel- oder Textilindustrie boomen klimafreundliche Produkte, kämpfen aber zunehmend gegen Greenwashing. Die Grundstoffindustrie hat jetzt die Chance, ihre Märkte durch Transparenz, Unabhängigkeit und Mitbestimmung in den Zertifizierungssystemen vor Greenwashing zu schützen. Besonders die Stahl- und die Zementindustrie nehmen hier unter den energieintensiven Sektoren die Vorreiterrolle ein.
Doch die Diskussion hält an. Trotz Fortschritten entstehen bei der Hochofenroute Emissionen, für die es bisher keine praktikablen Lösungen gibt. Ansätze konzentrieren sich darauf, prozessbedingt entstehendes CO₂ abzuscheiden und zu speichern (Carbon Capture and Storage – CCS) oder industriell weiterzuverwenden (Carbon Capture and Usage – CCU). Die Branche diskutiert derzeit verschiedene Technologiekombinationen an bestehenden Anlagen. CCS könnte dabei höchstens eine Übergangslösung für einen Teil der Emissionen bieten. Dennoch fehlen diese Technologien zurecht in LESS, da sie nur begrenzt einsetzbar sind, hohe Kosten verursachen, viel Energie erfordern und kurzfristig nicht skalierbar sind. Klar ist: Ohne einen grundlegenden Technologiewechsel bleibt die klimabelastende Hochofenroute unvermeidbar.
Wie die Stahlbranche den Wandel schaffen kann
Die Stahlindustrie steht vor einem tiefgreifenden Umbruch: Bis 2030 muss rund die Hälfte der deutschen Hochöfen ersetzt werden. Angesichts jahrzehntelanger Investitionszyklen gilt es, rechtzeitig die Weichen für eine treibhausgasneutrale Zukunft zu stellen. Doch der Umbau gelingt nur, wenn zentrale Voraussetzungen erfüllt sind: Produktionsorte brauchen ausreichend erneuerbaren Strom, Wasserstoff und passende Infrastruktur. Ebenso wichtig sind stabile wirtschaftliche und politische Rahmenbedingungen, etwa durch Klimaschutzverträge, Investitionshilfen oder EU-Mechanismen wie den Carbon Border Adjustment Mechanism, Taxonomie und Schutzmaßnahmen. Entscheidend ist auch, klimaneutralen Stahl regulatorisch aufzuwerten. Da er die gleiche Qualität wie konventioneller Stahl bietet, müssen öffentliche Beschaffung und eine ambitionierte CO₂-Bepreisung den Marktdurchbruch von zertifiziertem Stahl fördern.
Technologisch bleibt die wasserstoffbasierte Direktreduktion herausfordernd. Dennoch gehen Salzgitter und Stahl Holding Saar, zwei der vier größten Stahlhersteller in Deutschland voran: Sie planen, ihre kohlebasierten Hochöfen durch DRI-Anlagen zu ersetzen. Das ist ein klares Signal für den bevorstehenden Wandel der Branche.
Drei Fragen an ...
Jörg Kubitza, Ørsted
Im Interview erläutert Jörg Kubitza, welchen Beitrag die Offshore-Windindustrie zum Markthochlauf von grünem Stahl leisten kann.
Lisa-Maria Okken und Felix Schmidt, WWF Deutschland
Im Interview sprechen die Politikberater unter anderem darüber, wie der Europäische Emissionshandel als Investitionsanreiz in Transformationsmaßnahmen weiterentwickelt werden kann.

Copyright: Thomas Range, Bochum
Heiko Reese, IG Metall
Im Interview spricht Heiko Reese darüber, wie die Fachkräfte im Transformationsprozess der Stahlbranche aus Gewerkschaftsperspektive mitgenommen werden können.
Dr. Martin Theuringer, Wirtschaftsvereinigung Stahl
Dr. Martin Theuringer spricht über Herausforderungen für die Einführung von grünem Stahl und effektive Leitmarktinstrumente zur Sicherung dessen Wettbewerbsfähigkeit.
Geförderte Projekte
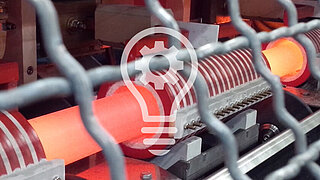
EVAGMH
Der Stahlhersteller Georgsmarienhütte errichtet eine mit Grünstrom betriebene induktive Einzelstabvergütungsanlage zur treibhausgasarmen Wärmebehandlung von Stabstahl.
EVA2GMH
Der Stahlhersteller Georgsmarienhütte errichtet eine mit Grünstrom betriebene induktive Einzelstabvergütungsanlage zur treibhausgasarmen Wärmebehandlung von Stabstahl mit großen Abmessungen.
WAGEOS2SHS
Die Lech-Stahlwerke und das Recyclingunternehmen Max Aicher Umwelt entwickeln mit den Zementproduzenten Holcim und Märker einen klimaschonenden Klinkerersatzstoff aus der Elektroofenschlacke von recyceltem Schrott.
Weitere Praxisbeispiele
Weiterführende Informationen
- Umweltbundesamt (2024): Berichterstattung unter der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen und dem Übereinkommen von Paris 2024. Nationaler Inventarbericht zum Deutschen Treibhausgasinventar 1990 – 2022. [PDF]
- Wirtschaftsvereinigung Stahl (2024): Daten und Fakten zur Stahlindustrie in Deutschland. [PDF]
- BMWK (2021): Stand der Gespräche zum Handlungskonzept Stahl zwischen dem Bundeswirtschaftsministerium und der Stahlindustrie in Deutschland.
- Agora Industry, Wuppertal Institute and Lund University (2024): Low-carbon technologies for the global steel transformation. A guide to the most effective ways to cut emissions in steelmaking. [PDF]
- S. Schreck, G. Kobiela, S. Wolf (2023): Klimaneutrale Stahlindustrie. Rahmenbedingungen für die Transformation in Deutschland. Bonn, Berlin: Germanwatch e.V. [PDF]
- LeadIT (2025): Green Steel Tracker. Stockholm: Leadership Group for Industry Transition.










